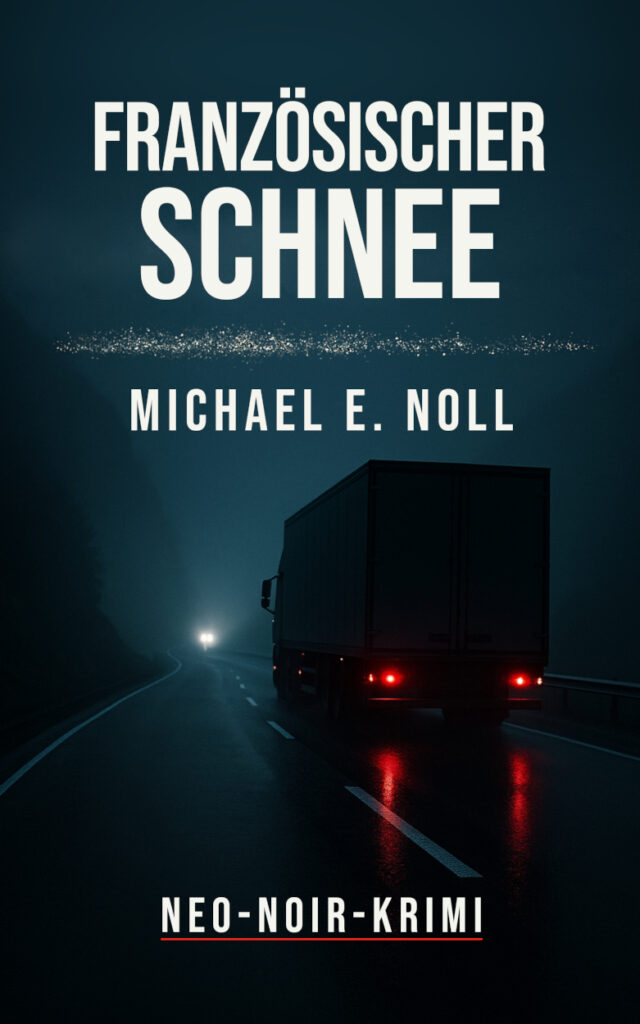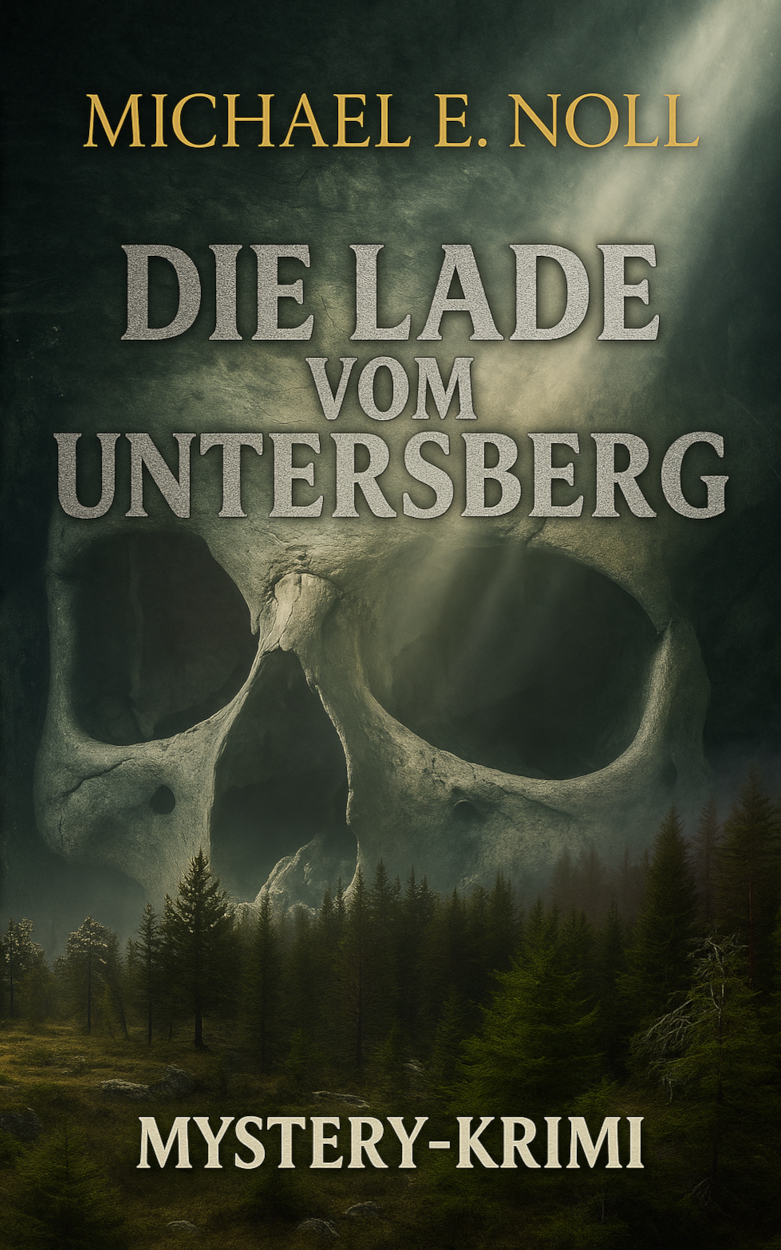Ein trostloser Morgen. Aus einer Laune heraus, entsprang dieser Text irgendwo zwischen Lyrik und Depression, vor einigen Jahren meiner Feder. Auch wenn auf meine persönliche Situation inzwischen nicht mehr ganz zutreffend, wird sich vielleicht der eine oder andere wiedererkennen.
Jäh findet die Glückseligkeit meiner Traumwelt ein Ende. Der Wecker klingelt erbarmungslos. Ich drücke die Schlummertaste. Für gewöhnlich genehmige ich mir noch zwei Schlummerphasen, ehe ich mich aus dem Bett quäle. Im Spiegel meines kleinen Badezimmers blickt mir ein trauriges Gesicht entgegen, das eigentlich noch gerne zwei Stunden liegen geblieben wäre; obwohl ich genug geschlafen habe. Zwei Gläser Wasser, für ein Frühstück ist an diesem trostlosen Morgen keine Zeit. Zudem ist mein Magen ohnehin noch nicht aufnahmefähig.
Vor dem Gebäude steht mein alter Ford, ich steige ein. Kälte umnebelt mich, ich kann meinen Atem sehen. Die Temperaturanzeige steht bei einem Grad Celsius, mir kommt es kälter vor. Ich starte den Motor und der betagte Diesel springt schwerfällig an; was für ein Glück. Das Auto scheint die Kälte genau so gerne zu mögen wie ich; nämlich überhaupt nicht. Ein Wintermensch war ich nie und mich daran zu gewöhnen, dessen verweigere ich mich vehement. Das Radio bleibt stumm. Auf diese Art der stumpfen Berieselung verzichte ich schon lange, da ich andernfalls befürchte, die geistige Verkümmerung könnte noch schneller voranschreiten als ohnehin. Vielleicht bin ich aber auch einfach nur ein Masochist, der sich das Elend gerne ungefiltert gibt.
Ich lasse den Wagen durch die Siedlung rollen, die nächste Haltestation ist der Bäcker, welcher nur einige hundert Meter von meiner Wohnung entfernt liegt. Zwei Kundinnen stehen vor mir an der Theke, kaufen Gebäck in einer Menge ein, die für mehrere Großfamilien reicht. Emsig laufen die Angestellten der Bäckerei hinter dem Tresen umher und lassen ein Gebäckstück nach dem anderen in die Tüten wandern. Diese füllen sich, doch die Kundinnen fordern erbarmungslos weiter und erinnern mich unweigerlich an meinen Wecker. Manchmal frage ich mich, ob diese Menschen keiner regulären Arbeit nachgehen oder die gesamte Belegschaft mit Brötchen versorgen müssen; oder ob sie einfach nur aus Boshaftigkeit den halben Laden leer kaufen, um mir meine wertvolle Zeit zu stehlen. Nach einer gefühlten Ewigkeit bin ich an der Reihe, werde mit einem aufgesetzten Lächeln begrüßt. Endlich halte ich meine Butterbreze in den Händen und verlasse den Laden zügig.
Der Höllenritt kann beginnen, vor mir liegen knapp dreißig Kilometer. Das tägliche Risiko, zu verunglücken, trage ich allein. Meine Mitmenschen scheinen dies hinzunehmen, ohne sich weitere Gedanken darüber zu machen, mich stört es zusehends, je älter ich werde. Man erzählt uns, wie gefährlich es anderorts auf der Welt sei, in Mittelamerika oder Südafrika beispielsweise, über das weit höhere und realere Risiko eines Verkehrsunfalls spricht jedoch niemand. Ich mag Autofahren nicht besonders, doch dort wo ich hinmuss, fährt kein Bus und mit dem Zug würde man aufgrund der unterentwickelten Infrastruktur die dreifache Zeit benötigen. Also wähle ich das geringere Übel. Autofahren ist für mich eine der unproduktivsten und eintönigsten Tätigkeiten überhaupt; ein Sinnbild verschwendeter Lebenszeit, die man neben viel Geld auf der Straße zurücklässt.
Noch blinzelt die Sonne hinter den Bergen hervor, aber das wird sich bald ändern. Schwarze Wolken wabern bereits unheilvoll in meine Richtung. Langsam komme ich meinem Ziel näher, jedoch will ich tief im Inneren gar nicht, ein Teil meiner Seele beginnt um Gnade zu winseln an diesem trostlosen Morgen.
»Man sollte sich eine Arbeit suchen, die einem Spaß macht.« Diesen Spruch höre ich des Öfteren und belächle die Menschen, die ihn fallen lassen. Für mich sind das nichts als hoffnungslose Träumer. Ich muss von etwas leben, meine überteuerte Wohnung bezahlen, meine beiden Kinder versorgen die nicht bei mir aufwachsen und etwas essen muss ich auch noch. Mit den Jobs, die mir Spaß machen würden verdient man kein Geld, es sei denn man hat einen großen Namen. »Jammern auf hohem Niveau!«, würde manch einer sagen. Natürlich, verglichen mit den Problemen der Menschen in der Dritten Welt oder in Schwellenländern, wirken die meinigen unbedeutend. Glücklicher macht mich dieser Gedanke trotzdem nicht, denn auch wir hier haben unsere Probleme. Der Kampf ums Überleben findet auf einem anderen Niveau statt; aber er findet statt.
An meinem Ziel erwarten mich acht Stunden vergeudete Lebenszeit, Fahrzeit und Pausen nicht einberechnet. Lebenszeit, die ich weit unter Wert verkaufe, jedoch habe ich keine andere Wahl als mich dem Markt zu fügen. Ich bin bereits mitten auf der Autobahn, als die weiße Pracht langsam auf die Frontscheibe rieselt. Es hat angefangen zu schneien und gerade ist das Risiko, tödlich zu verunglücken, exponentiell gestiegen. Eine reale Gefahr, die von allen Seiten salopp als hinnehmbar deklariert wird. Als ich die Abfahrt erreiche, kann ich die Sonne noch schwach an den Bergen erkennen, wie ein langsam versiegender Hoffnungsschimmer hinter all dem Grau. Nachdem ich die Abfahrt genommen habe, werde ich von zwei Lastwagen ausgebremst. Lastwagen mit italienischem Kennzeichen, die ihrer Kennzeichnung nach giftigen Sondermüll transportieren und aussehen, als gehörten sie selbst auf denselben.
Einige hundert Meter krieche ich ihnen hinterher, bis sie zu meiner großen Erleichterung schließlich nach links abbiegen und meinen Weg freimachen. Endlich, freie Fahrt auf der verschneiten Landstraße, ein seltener Anblick. Ein Eichhörnchen quert vor mir die Straße. Ich bremse, aber im letzten Moment entscheidet es sich zur Umkehr. Ein Tier, das unsere hektische Welt nicht versteht, knapp dem Tode entronnen. Ich wünsche ihm, beim nächsten Versuch eben so viel Glück zu haben. Zu viele davon habe ich bereits gesehen, unter die Räder gekommen und zu einem blutigen Matsch aus Gedärmen und Knochenbrei verarbeitet; ein Wahrzeichen der Rücksichtslosigkeit einer menschengeschaffenen Maschinerie deren Teil ich bin. Eine Maschinerie, der nicht nur hilflose Wesen zum Opfer fallen, sondern die auch Seelen frisst.
Ich habe mein Ziel fast erreicht. Plötzlich prasseln Hagelkörner wie aus einem Maschinengewehr abgefeuert auf meine Rostlaube ein und ich frage mich, ob es das wirklich alles wert ist; wieder einmal. Ich habe das Bedürfnis, mein Ziel möglichst schnell zu erreichen, doch ein Tross von Fahrzeugen hindert mich daran. Schließlich passiere ich das Ortsschild in Schrittgeschwindigkeit. Ich bin fast da. Ein Kaff, dessen größte Dreistigkeit in seiner bloßen Existenz besteht. Ein trostloser kalter Ort, bevölkert von Hinterwäldlern, die noch trister wirken als die grauen Fassaden um sie herum. Was Menschen dazu bewegt, hier eine Firma zu betreiben oder gar zu leben, wird mir auf ewig ein Rätsel bleiben. Den Sommer erkennt man hier lediglich daran, dass die Frauen ihre Wintermäntel offen tragen.
Ich rutsche um die Kurve und fahre in die Straße ein, in der das Gebäude meines Arbeitgebers steht. Nun beginnt die quälende Suche nach einem Parkplatz. Den letzten beißen die Hunde, in diesem Fall mich und ich scheine ihnen zu schmecken. Der Straßenrand ist gesäumt von Schneehaufen, was das ohnehin knappe Angebot noch zusätzlich reduziert. Schließlich finde ich eine Lücke und parke meine Klapperkiste vor dem protzigen Stadtgeländewagen irgendeines Emporkömmlings. Ich greife meine Butterbreze vom Beifahrersitz und steige aus, sofort schneidet sich eisiger Wind wie ein Messer in mein Gesicht und ich ziehe die Jacke hoch um mich vor der Schneepeitsche zu schützen. Zügig erreiche ich das Gebäude und stemple mich ein; ab jetzt arbeitet die Zeit für mich.