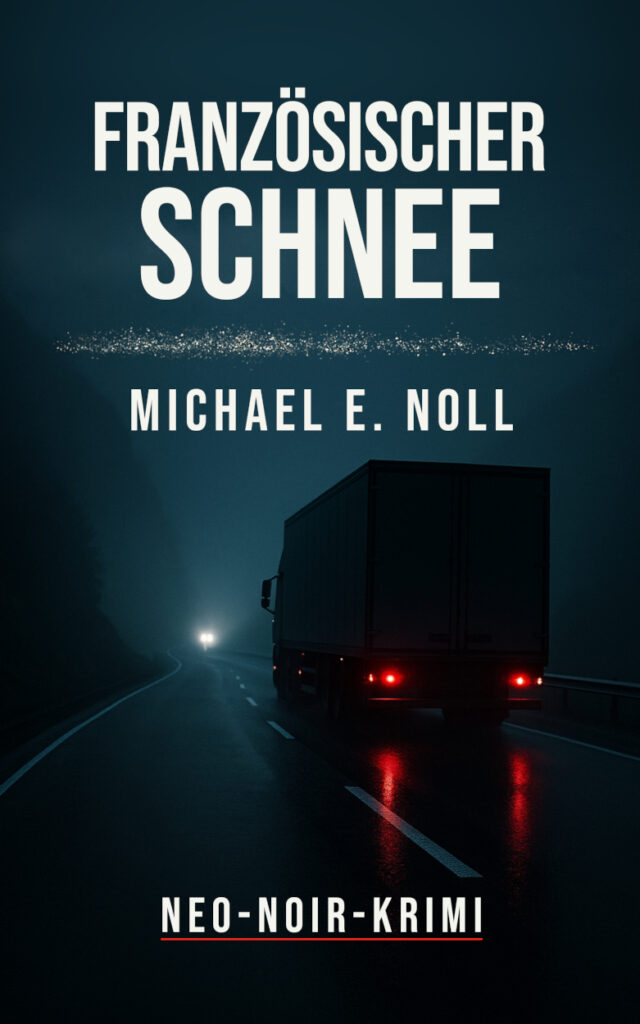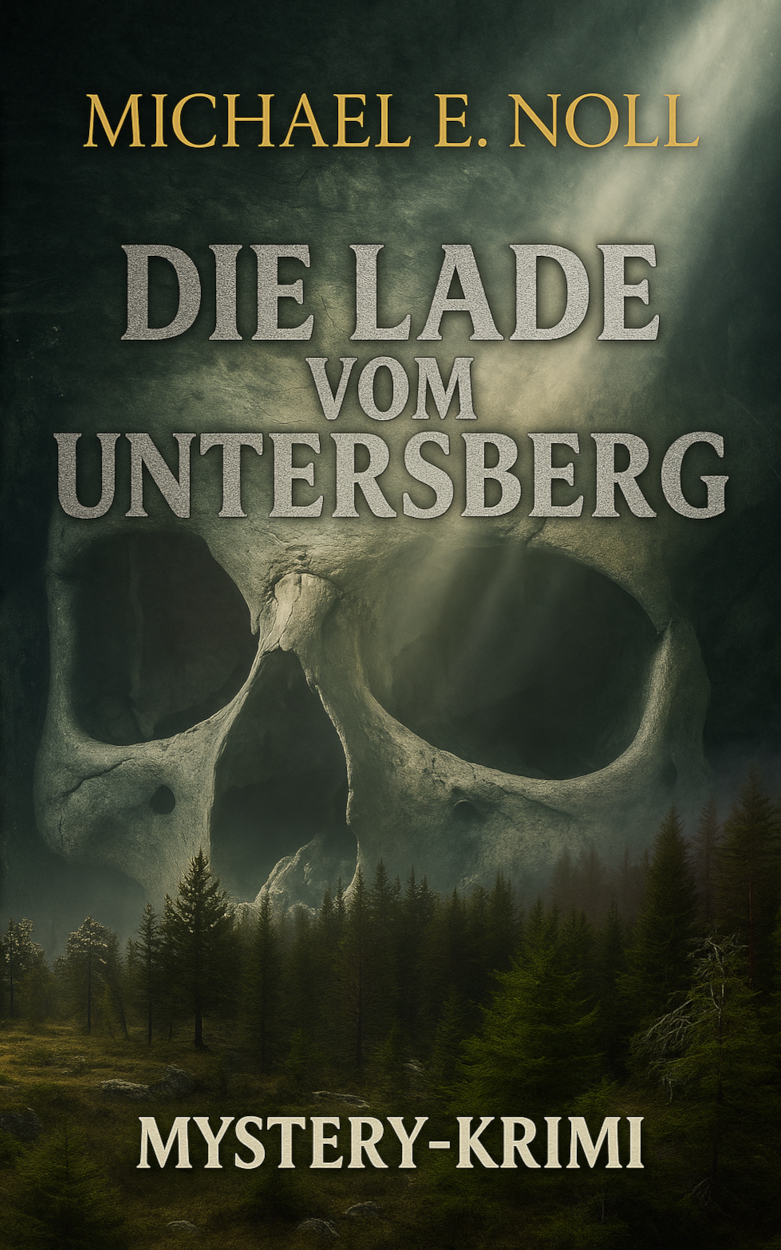[ Odessa 2018: Die Rückkehr – Teil 4 ]
Ich gebe es zu; die Euphorie, welche ich noch bei meinem ersten Besuch in Odessa verspürte, mag sich nicht mehr einstellen. Die Schattenseiten des Lebens hier drängen sich stärker denn je in meine Augen und das nicht allein, weil ich die Welt nun verstärkt aus dem Blickwinkel eines Menschen mit Behinderung zu betrachten versuche. Vielleicht trägt aber auch das Wetter seinen Teil dazu bei. Ich fühle mich abgebrühter, mein Auftreten wird härter und ich habe das Gefühl, auf der Straße kaum noch als Ausländer wahrgenommen zu werden. Zumindest dann nicht, wenn ich alleine unterwegs bin. Spreche ich Russisch, so hält man mich, wie schon beim letzten Mal, für jemanden aus dem Baltikum und es ist mir ganz recht, nicht als Deutscher erkannt zu werden.
Das Leben in der Ukraine scheint vor allem eines zu sein: hart und voller Entbehrungen. Viele Menschen hier arbeiten bis zu zwölf Stunden an sechs Tagen die Woche, für einen Hungerlohn. Sie klagen nicht, haben sich offenbar mit ihrem Schicksal arrangiert, aber wirklich glücklich wirken sie nicht. Wo in Deutschland Alkoholismus vor allem im Nachtleben sichtbar wird oder man ihn mancherorts gar als Kulturgut verklärt, tritt er einem hier eher unterschwellig im Alltag entgegen. Und das, obwohl Alkohol hier teuer ist – wenngleich für deutsche Maßstäbe billig. Über das Politikum, das man in Deutschland um Diesel und Abgasnormen zelebriert, kann man hier bestenfalls müde lächeln. An manchen Tagen stinkt die Luft nach verbranntem Öl. Sie ist stickig, die Straßen starren vor Dreck. Die Masse an Autos und die mächtigen Schiffsdiesel im Hafen fordern ihren Tribut.
Mülltrennung scheint ebenfalls ein Fremdwort zu sein. In die überquellenden Müllcontainer, die viele Straßenecken säumen, wird alles unsortiert hineingeworfen, egal ob Plastik, Papier oder Glas. Seit der russischen Annexion der Krim im Jahre 2014, erlebt Odessa eine regelrechte Renaissance als Tourismusziel. Das spült Geld in die Kassen, doch beim einfachen Volk kommt kaum etwas davon an. Während man die Vorzeigestraßen, Prachtmeilen und Denkmäler emsig renoviert und restauriert, bröckeln die Fassaden an anderen Stellen unaufhaltsam weg. Der Verfall zeigt sich umso stärker, je weiter man vom Zentrum weggelangt.
Die gigantischen Kaufhäuser und Einkaufszentren sind ebenfalls den Touristen und besser betuchten Odessitern gewidmet. Die meisten Einheimischen kommen an diesen Ort, um zu arbeiten. Die wenigsten von ihnen werden sich einen Einkauf hier leisten können. Dass Odessa sich gerade neu erfindet, spürt man an allen Ecken und Enden. Diese Metamorphose hat ihren Preis und die Schwächsten laufen Gefahr, unter die Räder zu geraten.
Gefühlt alle zwei Meter hält einem jemand die Hand oder den Kaffeebecher hin, in der ständigen Hoffnung auf ein paar Mitleids-Hrywnja. Die Menschen versuchen, nahezu aus allem Kapital zu schlagen. Männer mit Tauben, mit deren Vögeln man sich für eine kleine Spende an einem der Denkmäler ablichten lassen kann. Straßenmusikanten, Künstler, Artisten oder einfach nur schlichte Bettler, die in Lumpen herumlaufen und ihre auswendig gelernten Arien zum Besten geben; nahezu alles ist vertreten. Ebenfalls ein beliebtes Geschäftsmodell scheint es zu sein, sich eine Cappuccino-Maschine in den Kofferraum eines Fahrzeugs zu bauen und Kaffee in den verschiedensten Sorten anzubieten. An nahezu jeder Straßenecke trifft man auf solche provisorisch anmutenden Verkaufsstände.
Ich schiebe Rufus durch den Park, als wir einer hübschen aber sichtlich talentfreien Straßenmusikantin mit Gitarre über den Weg laufen. Taktisch geschickt an einer Engstelle am Eingangstor platziert, haut sie in die Klampfe, während sie dazu jault, wie ein angeschossener Hund. Neben ihr steht ein junger Mann und streckt uns eine Blechbüchse entgegen, fordert impertinent eine Spende ein. Wir passieren das Tor und ich lasse ihn links liegen. Wer aufdringlich bettelt, bekommt von mir grundsätzlich keine müde Kopeke.
Gleiches gilt für Wahrsagerinnen, die einen unvermittelt penetrant von der Seite anquatschen und einem Geheimnisse aus der Hand lesen oder die Zukunft voraussagen wollen. Meistens sind es Gruppen aus mehreren Frauen, die durch die Parks streifen und ihre potenziellen Opfer auskundschaften. Ein deutliches »verpiss dich« meinerseits und anschließend konsequentes Ignorieren verschafft Klarheit und hat sich als patente Lösung bewährt. Andere Bettler trauen sich angesichts der Tatsache, dass Rufus im Rollstuhl sitzt, erst gar nicht, uns anzusprechen.
Weniger hart reagiere ich, als uns ein herumstreunender Junge eine der Rosen aus seinem mitgeführten Strauß verkaufen will. Hier genügt ein freundliches »Nein danke«. Die Tatsache, dass in bestimmten Volksgruppen bereits die Kinder zur Erwirtschaftung von Profit instrumentalisiert werden, gehört hier zum Alltag. Der Gedanke an die Perspektivlosigkeit eines solchen Heranwachsenden, stimmt mich ein wenig traurig. Ein Beispiel, an welchem die Schattenseiten dieses schönen und zugleich so desolaten Landes besonders deutlich zutage treten.

Zwischen Rückwärtsgewandtheit und dem Versuch, den Anschluss an ein modernes Europa zu finden: Das Schild hinter diesem öffentlichen Fernsprecher wirbt für Englisch-Kurse.
Die Dämmerung ist hereingebrochen, aufgrund der Zeitverschiebung von einer Stunde, schon früher als in der Heimat. Gerade haben wir Rufus im Hotel abgeliefert und uns für später verabredet. Auf dem Rückweg halte ich an einem Geldautomaten, der an einer Hauswand angebracht ist. Ich hebe 2000 Hrywnja ab, was etwa 60 € entspricht. Der Automat spuckt ein dickes Bündel Geldscheine aus, welches ich umgehend in meiner Hosentasche verschwinden lasse. Mit Geld sollte ich hier auf der Straße nicht herumhantieren, wenn man bedenkt, dass ich gerade den halben Durchschnitts-Monatslohn eines Einheimischen in der Hand halte.
Dann der Schock. Der Geldautomat spuckt meine Karte nicht mehr aus. Er schreibt zwar, dass ich diese entnehmen solle, ich warte jedoch vergeblich. Kurz darauf folgt wieder die Aufforderung, dass ich meine Geheimzahl eingeben solle. Ich versuche es abermals, aber die Karte bleibt verschwunden. Rudi hält mir den Rücken frei, während sich bereits eine Schlange hinter uns bildet. Was für eine unangenehme Situation. Wieder erscheint das Eingabefeld für den PIN-Code. Eine Uhr läuft und ich habe 60 Sekunden Zeit, andernfalls würde der Automat meine Karte einziehen. Der Gedanke, dass meine Kreditkarte in irgendeinem Straßenautomaten in Odessa verschwindet, gefällt mir überhaupt nicht und macht mich entsprechend nervös.
Wieder und wieder versuche ich, das Gerät zum Auswerfen meiner Karte zu bewegen. Rudi erkennt die Situation und staubt die Wartenden hinter uns kurzerhand weg. Vielleicht ist es aber auch der Gedanke an einen kartenfressenden Bankomaten, der die Leute schließlich bewegt, es hier lieber nicht zu versuchen. Ich gebe der Sache noch einen letzten Versuch und endlich; die Karte schiebt sich aus dem Schlitz. Meine sich aufstauende Wut weicht dem Gefühl der Erleichterung. An diesem verfluchten Drecksteil werde ich sicher kein Geld mehr abheben.
Zu späterer Stunde erkunde ich mit Rufus zusammen das Nachtleben. Als wir an einer Ampel stehen, erblicke ich inmitten der Kreuzung eine alte Bekannte wieder. Eine Bettlerin, die in Wirklichkeit kerngesund ist, zieht wieder einmal ihr erbärmliches Schauspiel ab. Auf eine Krücke gestützt, mimt sie eine körperliche Behinderung, um des Mitleids der Autofahrer Willen. Ich staune darüber, welche Verrenkungen ein gesunder Mensch zustande bringt, nur um als behindert zu gelten. Für einige Augenblicke sehen wir uns die lächerliche Darbietung an, bevor wir schließlich die Straße überqueren.
Als ein Mann im dunklen Geländewagen tatsächlich anhält und ein paar Scheine durch das Fenster reicht, beginnt unmittelbar hinter ihm ein Hupkonzert der Verständnislosigkeit zu toben. Auf der anderen Straßenseite erwartet uns wieder einmal eine baustellenbedingte Sandwüste. Doch anstatt diese zu umfahren, will es Rufus wissen und wir steuern mittendurch. Weit kommen wir allerdings nicht, denn nach bereits etwas zehn Zentimetern bleiben wir gnadenlos stecken. Rückwärts ziehe ich ihn an die Straße und wir verewigen uns mit einer entsprechenden Spur in dem losen Untergrund.
In unserer Stammbar beobachten wir an einem Nebentisch eine bekannte Konstellation. Ein etwa 60-jähriger Mann, dem Akzent nach ein englischer Tourist mit vermutlich dickem Geldbeutel, sitzt neben einer etwa 25-jährigen Ukrainerin. Anhand ihres Goldgräberblicks verorte ich sie sofort als einen dieser abgebrühten Lockvögel, mittels derer man damals versuchte, Rudi und mich in die Falle zu locken. Ich äußere die Vermutung, dass der arme Kerl an diesem Abend wohl noch richtig abgerippt werden wird und ernte Zustimmung. Andererseits frage ich mich, welches Maß an Naivität es braucht, ein so offenkundiges Machtgefälle als »Romantik« zu deuten. Laut Rufus hat ein solches Opfergesicht nichts anderes verdient.
Ich überlege, ob ich ihm eine Warnung zukommen lassen soll, sobald seine Begleitung die Toilette aufsucht. Aber die weiß offensichtlich genau, was Sache ist und bleibt den ganzen Aufenthalt über konsequent neben ihrem Opfer sitzen. Nachdem sich das Aas auf seine Kosten den Magen vollgeschlagen hat, bezahlt er und die beiden verlassen das Lokal. Von einer örtlichen Partnersuche via Dating-App ist in Odessa dringend abzuraten. Mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit trifft man dort auf Prostituierte, Ködermädchen der lokalen Mafia oder anderes Ungemach. Meine erste Odessa-Story schlug zwischenzeitlich hohe Wellen und verschiedene Männer aus aller Welt meldeten sich aufgrund meines Berichts oder einer meiner Rezensionen. Sie berichteten von ähnlichen Erfahrungen, teilweise im gleichen Club. In der Ukraine hat man offensichtlich noch nicht überall begriffen, wie nachhaltiger Tourismus funktioniert.
Nach unserem Drink bringe ich Rufus nach Hause und mache mich dann selbst auf den Heimweg. In der Küche werde ich bereits von Rudi erwartet, der eine weitere, potenziell nachtfüllende Wodka-Runde eingeläutet hat. Da ich keine Lust auf Katerstimmung am nächsten Morgen habe, lasse ich es heute eher ruhig angehen. Als Orangensaft und Wodka trotzdem langsam knapp werden, mache ich mich nochmals auf den Weg in den nahegelegenen Supermarkt, um Nachschub zu organisieren. Aufgewärmt, aber nicht angetrunken, marschiere ich aus dem Laden – unter dem linken Arm die Flasche Wodka und die Safttüte geklemmt, in der rechten Hand einen 6-Liter-Kanister Wasser. Nach etwa hundert Metern kommt mir ein Betrunkener entgegen, der mich umgehend auffordert, ich solle ihm Geld geben. Er hat etwa meine Statur und Größe und sieht nicht aus wie ein Obdachloser.

An vielen Geschäften, Bars und Gebäuden findet man diese Aufkleber, die auf den Schutz durch den Sicherheitsdienst »Ochorona« hinweisen. Die offizielle Polizei ist entweder nicht in der Lage, die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten oder hat kein großes Interesse daran.
Als ich ihm daraufhin unmissverständlich mitteile, dass er sich verziehen solle, wird er aggressiv und will mir ans Revers greifen. Ich mache einen Ausfallschritt nach hinten, ziehe mit der Rechten aus und lasse den Wasserkanister gegen seinen Kopf krachen. Erstaunlicherweise hält der windige Plastikhenkel dem Einschlag stand, und der Trunkenbold kippt um wie ein Brett. Für einen kurzen Moment liegt er reglos da, doch dann zuckt er, wälzt sich am Boden, hält schützend die Hände vors Gesicht und winselt um Gnade. Ich überlasse ihn seinem Schicksal und setze den Heimweg fort.

Dient im Zweifel auch als Schlagwaffe zur Selbstverteidigung: ein Wasserkanister der Marke »Morshinska«.
Zurück in der Küche, berichte ich Rudi von meinem Erlebnis. Dieser hatte in der Zwischenzeit auch einen Kampf zu bestreiten, allerdings nur mit einer Kakerlake. Diese treten hier gelegentlich auf, in vergleichsweise kleiner Ausführung. In der Küche braucht die Viecher trotzdem niemand.Nach diesem ereignisreichen Tag und einer ordentlichen Menge Alkohol übermannt mich auf der erstaunlich bequemen Gästecouch schließlich der Schlaf.